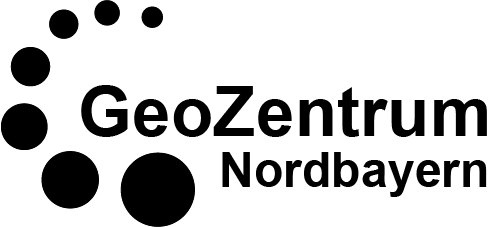Patrick Hehn

Patrick Hehn
Lehrstuhl für Endogene Geodynamik
Wissenschaftliche Mitarbeitende
Adresse
Kontakt
Forschungsthemen:
- Entstehung von paläoproterozoischen orthomagmatischen Sulfidlagerstätten im Vammala Belt, Südwestfinnland.
Dieses Projekt untersucht die Gesteins- und Erzgenese der vor ca. 1,89 Milliarden Jahren intrudierten ultramafischen Kylmäkoski- und Stormi-Lagerstätten im südwestlichen Finnland. Der Vammala Belt beherbergt mehrere paläoproterozoische orthomagmatische Ni-Cu-(Co)-Sulfiderzlagerstätten, deren Entstehungsprozesse bislang nur teilweise geklärt sind.
Diese Sulfiderzlagerstätten bildeten sich im Zuge der svekofennischen Orogenese (1,87–1,89 Ga) entlang einer Subduktionszone. Die vererzten ultramafischen Kumulate repräsentieren tiefe Krustenbereiche. Die wichtigsten Erzminerale sind Pyrrhotin, Pentlandit, Chalkopyrit und Cubanit, die in Peridotiten, Amphiboliten und Pyroxeniten auftreten.
In dieser Studie werden geochemische Analysen (Haupt- und Spurenelemente, Gesamtgestein, δ34S-Isotope) mit petrologischen und texturellen Beobachtungen kombiniert, um zu bestimmen, welchen Einfluss die Schmelzentwicklung, Temperatur, Druck, Wassergehalt und Sauerstofffugazität auf die Sulfidsättigung hatten.
Die Ergebnisse legen nahe, dass die Assimilation externen Schwefels aus sedimentären Gesteinen wahrscheinlich nicht der Hauptmechanismus für die Sulfidsättigung war, so wie es oft für orthomagmatische Sulfiderzlagerstätten an Subduktionszonen angenommen wird. Stattdessen führte die fraktionierte Kristallisation der Silikatschmelze zur Anreicherung von Schwefel. Die Kristallisation von Magnetit und die damit verbundene Abnahme der Sauerstofffugazität resultierten in einer späten Sulfidabscheidung.
Da die Redoxbedingungen der paläoproterozoischen Kylmäkoski- und Stormi-Schmelzen modernen Subduktionsmagmen ähneln, könnten phanerozoische orthomagmatische Ni-Cu-Lagerstätten durch ähnliche Mechanismen entstanden sein. Dies deutet darauf hin, dass eine Assimilation von Krustengestein nicht immer erforderlich ist, um wirtschaftlich bedeutsame magmatische Sulfidlagerstätten zu bilden.
Verwendete Methoden:
- Elektronenstrahlmikrosonde (EPMA)
- Rasterelektronenmikroskopie (REM)
- Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
- Induktiv gekoppelte Laserablation-Massenspektrometrie (LA-ICP-MS)
- Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)
- Element Analyzer-Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA-IRMS)
- Mechanismen der Ni- und Co-Anreicherung in hydrothermalen Sulfiden der ultramafischen Kylylahti VMS-Lagerstätte, Finnland
Die Kylylahti-Lagerstätte ist eine ultramafische, vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätte (VMS) und Teil des Outokumpu-Bergbaudistrikts in Ostfinnland. Auffallend sind die starken Nickel- und Cobalt-Anreicherungen im Vergleich zu modernen hydrothermalen Systemen am Ozeanboden („Black Smokers“). Die Mechanismen dieser Anreicherung sind bislang unklar und stehen im Mittelpunkt dieses Forschungsprojekts.
Die wichtigsten Erzminerale sind Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit, Pyrrhotin, Magnetit, Pentlandit und Cobalt-Pentlandit. Besonders bemerkenswert ist die Konzentration von Cobalt-Pentlandit, der in einer „High-Co-Zone“ im Zentrum des Erzkörpers gehäuft vorkommt und bis in die „Low-Co-Zone“ am Rand des Erzkörpers nachweisbar ist.
Die Temperatur gilt als zentraler Kontrollfaktor für die Co-Anreicherung: Mit steigender Temperatur zum Zentrum des Erzkörpers nimmt das Co/Ni-Verhältnis in Pentlandit und Cobalt-Pentlandit zu. Blei- und Schwefelisotopenanalysen deuten darauf hin, dass die metamorphen Fluide, die zur Metallanreicherung führten, ihren Ursprung in den umgebenden Schwarzschiefern hatten.
Im Projekt sollen der Ursprung der Ni- und Co-Anreicherung sowie die metamorph bedingten Metallanreicherungsprozesse detailliert untersucht werden. Mithilfe von EBSD (Electron Backscatter Diffraction) sollen Deformationsstrukturen in Gesteinen und Mineralkörnern analysiert werden, um Zonen erhöhter Spannung und Druckschatten zu identifizieren. Dies könnte helfen, die Entstehung sekundärer Sulfidphasen präzise metamorphen und tektonischen Prozessen zuzuordnen und so deren Ursprung besser zu verstehen.
Verwendete Methoden:
- Elektronenstrahlmikrosonde (EPMA)
- Rasterelektronenmikroskopie (REM)
- Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
- Induktiv gekoppelte Laserablation-Massenspektrometrie (LA-ICP-MS)
- Element Analyzer-Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA-IRMS)
- Electron Backscatter Diffraction (EBSD)